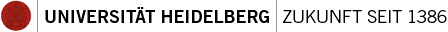Prof. Dr. Wilfried Härle
Wissenschaftlich-Theologisches Seminar der Universität Heidelberg

Interview vom 17. Oktober 2009 mit Marion Bär
Herr Professor Härle, im Rahmen des NAR-Seminars (17.11.2009) sprechen Sie über den Umgang mit unerträglichem Leiden. Viele Menschen fürchten sich davor, am Ende ihres Lebens in einen Zustand unerträglichen Leidens zu geraten. Als Ethiker und als Seelsorger kennen Sie diese Furcht sicher sehr gut. Menschliches Leiden am Lebensende hat viele Gesichter: Schmerzen, Angst, Verzweiflung. Wann aber wird Leiden zu unerträglichem Leiden?
Da beginnen Sie mit der schwierigsten Frage. Häufig haben wir hier eine paradoxe Situation. Ein schwer kranker oder sterbender Mensch sagt: „Mein Leiden ist unerträglich“ und ein Außenstehender entgegnet (oder denkt bei sich): „Aber du erträgst es doch! Du hast dir doch noch nicht das Leben genommen“. Mit einer solchen Logik wird man aber dem Sinn dieser Aussage und dieses Wortes nicht gerecht, das meint: „Ich bin nicht in der Lage, das weiterhin zu ertragen! Ich kann nicht mehr!“ Und über unser Können ist letztlich niemand Anderer befugt, etwas zu sagen. Diese Aussage muss ernst genommen werden, selbst wenn man aus der Distanz vielleicht sagen kann, da leiden zwei Patienten an demselben, und der eine wird damit fertig und warum der andere nicht? Natürlich kann man jemanden ermutigen, es noch ein wenig weiter zu versuchen. Aber letztlich kann nur die betroffene Person sagen „es geht nicht mehr“.
Wenn man das Wort „unerträglich“ also nicht wegschiebt, dann erschließt die Aussage: „ich leide unerträglich“ eine wichtige Botschaft. Sie besagt: „Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie du mir helfen kannst, dass ich wieder zu einem Leben komme, von dem ich sagen kann, ich kann es ertragen. Es ist vielleicht nicht das, was ich mir gewünscht habe, es ist schwer, aber es geht!“
Wenn von unerträglichem Leiden die Rede ist, geht es häufig um Menschen, die nicht oder nicht mehr für sich selbst sprechen können: Kleinkinder, Menschen mit schweren Behinderungen, Komapatienten, Menschen mit Demenz….
Zunächst: Man kann unerträgliches Leiden auf vielfältige Weise mitteilen, auch wenn die Sprache nicht (mehr) zur Verfügung steht. Durch den Gesichtsausdruck, durch Schreie oder Körperhaltungen. Wenn wir im Umgang mit den betroffenen Menschen wachsam sind, so haben wir durchaus Möglichkeiten, festzustellen, dass ein Mensch unerträgliche Schmerzen haben muss, auch wenn dieser das Wort „Schmerz“ oder „unerträglich“ gar nicht ausgesprochen hat.
Ein weiteres: Von den Personengruppen, die Sie angesprochen haben, wird häufig sehr pauschal geurteilt, dass sie unerträglich leiden. Man muss mit solchen Fremddiagnosen aber vorsichtig sein! Nehmen Sie das Bespiel eines Menschen im Wachkoma: Da wird auf der einen Seite gesagt, er sei nicht mehr in der Lage, etwas zu fühlen, auf der anderen Seite wird behauptet, er leide unerträglich. Was stimmt denn nun? Sehr oft sind solche Aussagen Projektionen: „In so einer Situation muss man doch unerträglich leiden!“ In manchen Fällen mag so eine Projektion berechtigt sein. Trotzdem bin ich solchen pauschalen Fremddiagnosen gegenüber skeptisch.
Nicht nur der unmittelbar betroffene Mensch leidet in einer solchen Situation, sondern auch die Menschen, die ihm nahe stehen und ihn begleiten. Was ist das für ein Leiden der Anderen?
Das ist, glaube ich, ein mehrfaches Leiden. Einmal das Leiden an einer Unsicherheit: Ich weiß nicht, wie es dem Anderen wirklich geht. Ich kann alles Mögliche hören, sehen, vergleichen (wie war es vor einer Woche, wie war es früher, wie war es schon immer), aber ich habe nicht die Möglichkeit, in den Betroffenen hineinzusehen.
Das zweite, was dazu kommt, ist diese schreckliche Hilflosigkeit. Ich sitze daneben, als Angehöriger, Arzt, Krankenschwester, möchte so gerne helfen und kann es nicht. Und dann erlebe ich vielleicht noch den Appell: „Hilf mir doch!“ Und ich komme immer wieder hin und merke, dass sich die Situation nicht bessert. Hier entsteht oft ein Leidensdruck und eine Unsicherheitssituation, aus der man am liebsten fliehen möchte.
Ein hochrangiger Palliativmediziner hat einmal in einem Vortrag bekannt, dass er bei den wenigen Patienten, bei denen er die Schmerzen nicht in den Griff bekomme, den Impuls verspüre, bei der Visite am Zimmer vorbei zu gehen. Er habe aber diesem Impuls widerstanden, sei hineingegangen und habe der Patientin gesagt: „Es tut mir so leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann!“ Und da habe die Frau ihm ihre Hand auf den Arm gelegt und gesagt: „Aber Herr Professor, Sie helfen mir doch. Sie kommen doch jeden Tag zur Visite.“ Daran hatte er überhaupt nicht gedacht, dass die Tatsache, dass er nicht vom Krankenbett geflohen war, sondern mit seinen begrenzten medizinischen Möglichkeiten die Situation ausgehalten hat, dadurch also, dass er die Patientin nicht im Stich gelassen hat, für die Frau schon ungeheuer tröstlich war.
Das heißt also: Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr tun, kann ich zumindest für den Anderen da sein?
So ist es. Und dieses Da-sein wird in seiner Bedeutung oft unterschätzt. Bei Angehörigen spielt allerdings auch der Zeitfaktor eine Rolle: Wie lange kann jemand es ertragen, zu merken, dass es nicht vorwärts geht und die Situation immer noch so verzweifelt ist? Eine der großen Fragen im Hinblick auf Klinikseelsorge ist für mich, ob Klinikseelsorger nicht viel mehr den Fokus ihrer Aufmerksamkeit auf die Angehörigen richten müssten, die unter solchen Situationen unerträglichen Leidens selber unerträglich leiden.
Wenn meine Kraft als Angehöriger erschöpft ist und ich das Gefühl habe, jetzt kann ich es nicht mehr ertragen: Was kann ich denn dann tun?
Als Seelsorger würde ich Angehörige immer dazu ermutigen, dass sie sich im Rahmen des Möglichen Freiräume schaffen, auch etwas für sich selbst zu tun: Durchatmen können, etwas Positives erleben können. Das ist oft kein leichter Schritt. Vom Patienten kann ich dabei höchstens erhoffen, dass er mir diesen Freiraum lässt. Dass er sagt: Ja, mach das, das ist o.k.! Denn das ist notwendig! Nicht nur, damit Angehörige die Pflege oder die Begleitung weiter leisten können, sondern auch, damit das kostbarste zwischen Patient und Angehörigem nicht verloren geht: Die Beziehung, die gemeinsame Geschichte, Erinnerungen und Erfahrungen, die so lange getragen haben.
Schwingt bei der Angst vor dem unerträglichen Leiden nicht auch die Angst mit, anderen Menschen ausgeliefert zu sein, nicht mehr über sich selbst bestimmen zu können?
In unserer Gesellschaft gibt es in der Tat eine überzogene Angst vor einem Ende, in dem ich nicht mehr auf der Kommandobrücke des Lebens stehe, sondern in dem andere über mich bestimmen. Einem Ende, bei dem ich zum Beispiel meine Ausscheidungsfunktionen nicht mehr unter Kontrolle habe und wie ein Säugling in die Hosen mache. Menschen haben eine panische Angst davor, dass ihr Leben ungefähr so hilflos und hilfsbedürftig enden könnte, wie es begonnen hat.
Diese Angst nährt sich von der Vorstellung, Menschenwürde sei Selbstbestimmung. Wenn das stimmt, dann verlieren wir mit unseren Selbstbestimmungsmöglichkeiten am Lebensende die Menschenwürde, und das wäre ja das schlimmste, was man sich vorstellen kann. Deshalb kämpfe ich gegen diese Gleichsetzung von Selbstbestimmung und Menschenwürde mit allem Nachdruck. Die Menschenwürde ist ein Anspruch auf Achtung, den jeder Mensch vom Anfang bis zum letzten Ende hat, völlig unabhängig von seinen Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Wenn sich diese Sichtweise durchsetzt, wäre das vielleicht ein Beitrag dazu, zu erkennen: Die Würde eines Menschen steht nicht dadurch in Frage, dass wir zum Schluss auf die Hilfe Anderer angewiesen sind.
Gerade im vorgerückten Alter stellt sich vielen Menschen die Frage, wie sie im Vorblick auf ihr Lebensende selbstverantwortlich handeln können. Was kann ich denn konkret tun?
Martin Luther hat als relativ junger Mönch eine sehr schöne Schrift verfasst: Der „Sermon von der Bereitung zum Sterben“. Da fängt er ganz nüchtern und praktisch an und sagt: Erstmal, zahl deine Schulden und sieh zu, dass du deine Erbangelegenheiten ordnest. Und wenn du die äußeren Dinge deines Lebens geordnet hast, dann hör auf, über Sünde, Tod und Teufel nachzudenken, sondern richte Deine Vorstellungen und Deine Gedanken auf das, was Dir verheißen ist. Ich möchte jetzt vor allem den ersten Teil stark machen: Ich habe in meinem Umfeld Menschen erlebt, die nichts geordnet hatten, und die ihren Kindern, den ganzen Schlamassel von ungeklärten Erbfragen hinterlassen haben, mit der Folge, dass die heute nicht mehr miteinander reden können, sondern sich völlig entzweit haben. Das finde ich unverantwortlich. Beizeiten solche Angelegenheiten zu ordnen, auch ungeklärte Beziehungsdinge und Konflikte nach Möglichkeit noch ins Reine zu bringen, das ist wichtig.
Das nächste ist, für sich selbst und im Gespräch mit Anderen die Frage zu klären: Wie möchte ich sterben? Gegenwärtig wird viel über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gesprochen. Ich sage entschieden Ja zur Vorsorgevollmacht, also zu einer Erklärung, die festlegt, wer einmal an meiner Stelle darüber entscheiden soll, was mit mir getan und nicht mehr getan wird. Kritisch sehe ich dagegen die Patientenverfügung, die jetzt schon bestimmen will, was dann alles getan oder nicht mehr getan werden darf, wo man doch nur sagen kann: Wir können es gar nicht wissen! Wir wissen nicht einmal, was dann medizinisch möglich ist. Aber wir können uns überlegen: Gibt es einen Menschen unseres Vertrauens, dem ich jetzt schon ein paar Dinge mitgeben kann. Ich habe zum Beispiel mit dem Menschen, der meine Vorsorgevollmacht hat, ein langes Gespräch geführt, das ich zusammenfassen konnte zu einem ganz einfachen Satz: Ich möchte so natürlich wie möglich sterben. Das heißt: So wenig wie möglich gewaltsames Verlängern oder gewaltsames Abkürzen. Zu Ende gehen lassen - das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und wie das dann einmal im konkreten Fall aussehen wird, da habe ich Vertrauen, dass mein Bevollmächtigter die Situation beurteilen können wird, so dass ich das nicht im Einzelnen verfügen muss.
Das Verhältnis zum Leiden hat sich in unserer Gesellschaft gewandelt. In früheren Zeiten wurde menschliches Leiden oft als etwas wahrgenommen, was einen Sinn hatte. Heute ist es selbstverständlich geworden, nicht zu leiden. Ist es heute schwerer geworden, mit unabwendbarem Leiden umzugehen?
Ja. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich kann hierzu das Buch „Brave New World“ von Aldous Huxley empfehlen. Er stellt sich darin eine Welt vor, in der es mit Hilfe von genetischen Eingriffen, medikamentösen Dauereinstellungen und pädagogischen Zusatzmaßnahmen gelungen ist, Leiden, Schmerzen und das Böse auszurotten. Als Huxley anfing, dieses Buch zu schreiben, war er wirklich der Meinung, das sei das Paradies. Und während er das Buch schreibt, wird ihm bewusst: Das ist die Hölle! Alles, was uns Menschen Tiefe, Gewicht, Wert gibt, wäre dann ausgetilgt. Dieses Buch kann einem auf eine sehr einfühlsame Weise zeigen, was verloren geht und gegangen ist in einer Welt, die das Leiden als etwas versteht, was auf keinen Fall sein darf.
Was brauchen wir? Brauchen wir Vorbilder, die uns zeigen, wie wir mit Leiden umgehen können?
Wir brauchen Vertrauen. Vertrauen darauf, dass das Leben trägt, weil es getragen wird. Dann kann man sagen: „Ich kann mich darauf einlassen, es hat alles einen guten Sinn!“ (das ist ja ein Riesenvertrauen!). Ich glaube, Vertrauen ist das wichtigste Gut, was eine Gesellschaft überhaupt haben kann und was Menschen in ihrem Leben haben können.
Was wir außerdem brauchen, sind Gespräche wie das, was wir gerade führen. Und zwar nicht erst dann, wenn eine kritische Situation eingetreten ist, sondern viel früher, schon in der Schule. Ich führe zur Zeit zusammen mit anderen ein Schulprojekt durch zum Thema „Menschenwürde am Anfang und am Lebensende“. Da machen wir die Erfahrung, dass die Beschäftigung mit dem Thema viel bewegt und viel Angst abbaut.
In den letzten Jahren haben sich sowohl der deutsche Ethikrat als auch andere Ethikgremien der Bundesrepublik Deutschland mit dem Thema des unerträglichen Leidens befasst. Sind wir auf dem Weg zu einem angemessenen Umgang mit dem unerträglichen Leiden weitergekommen?
Ja, wir sind weitergekommen! Dieser Prozess hat vor über 50 Jahren begonnen, im Jahr 1957, als sich eine Gruppe von Anästhesisten im Rahmen eines Kongresses in Rom an den damaligen Papst Pius XII. gewandt hat mit der Frage: Wenn wir unerträgliches Leiden am Lebensende lindern, indem wir schmerzstillende Mittel geben (beispielsweise Opiate oder Narkotika), in dem Wissen, dass wir damit auch das Leben verkürzen - dürfen wir das? Und der Papst hat hier eine sehr einfache und überzeugende Antwort gegeben: Es kommt auf die Intention an, mit der ihr das tut. Ist es eure Absicht, ein menschliches Leben zu beenden, also jemanden zu töten, dann ist das verwerflich. Ist es aber eure Absicht, Schmerzen zu lindern, und nehmt ihr dafür im Notfall in Kauf, dass ein menschliches Leben verkürzt wird, dann ist das ethisch vertretbar. Dieser Standpunkt wird heute wohl von niemandem mehr bestritten, da gibt es einen ganz breiten Konsens.
Konsens besteht auch im Hinblick auf die so genannte „passive Sterbehilfe“, also das Sterbenlassen auf Wunsch des Patienten. Dafür brauchen wir eine Medizin, die loslassen kann: Wenn ein Leben zuende gehen will, und wenn der Patient auch sterben will, dann soll man keine neue Therapie mehr beginnen, und auch schon laufende therapeutische Maßnahmen beenden. Diese Position wird eigentlich nur von Peter Singer abgelehnt, weil er die Unterscheidung zwischen Sterben-lassen und Töten bestreitet.
Und schließlich haben wir in Deutschland einen breiten, allerdings nicht vollständigen Konsens über die Ablehnung der Tötung auf Verlangen. Selbst wenn es Situationen gibt, in denen ich nichts sehnlicher für mich oder für Andere wünsche, als dass das Leben jetzt zu Ende geht: Einen Menschen sterben zu lassen, das ist die Bestimmung jedes Menschen. Ihn zu töten, das ist die Bestimmung keines Menschen! Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es auch nicht fair, wenn Sterbende den Ärzten oder Angehörigen zumuten: Bring mich um, ich kann nicht mehr, und sieh dann zu, wie du damit leben kannst.
Dass wir diesen vollständigen Konsens im Blick auf die Schmerzbehandlung und das Sterben lassen und diesen weitgehenden Konsens im Blick auf die Nicht-Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen haben, ist nicht wenig!
Zur Person
Wilfried Härle, geboren 1941, ist evangelischer Theologe und Professor Emeritus für Systematische Theologie und Ethik an der Universität Heidelberg. Nach dem Studium der Theologie in Heidelberg und Erlangen führt ihn sein beruflicher Weg an die Universitäten Erlangen, Bochum, Kiel und Groningen (Niederlande). Ab 1978 war er Professor für Theologiegeschichte und Systematische Theologie an der Universität Marburg. 1995 folgte dann der Ruf nach Heidelberg. Daneben war er Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Ethik und Recht der modernen Medizin“ und Geschäftsführender Direktor des Interdisziplinären Forums für Biomedizin und Kulturwissenschaften. Er ist Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied der Europäischen Akademie für Wissenschaften und Künste.
Dass Professor Härle seit 2006 emeritiert ist, dürfte sein Terminkalender noch nicht bemerkt haben: Vortragsreisen, Seminare - und die Arbeit an dem von ihm geleiteten Projekt „Menschenwürde am Anfang und am Lebensende“ des Forschungszentrums Internationale und Interdisziplinäre Theologie (FIIT). Momentan aber ruft vor allem der Schreibtisch: Drei Buchprojekte wollen abgeschlossen werden, unter anderem zu den Themenbereichen Ethik, Menschenwürde und Grenzsituationen.
Daneben ist die Musik ein zentrales Thema in seinem Leben. Das jahrelange Chorsingen musste er zwar aufgeben - dazu reichte die Zeit nicht mehr. Dafür widmet er sich gerne seinem Cello, das er erst spät im Alter von 42 Jahren begonnen hat zu erlernen. Und nicht zu vergessen - die Literatur: „Ich versuche keinen Tag vergehen zu lassen, ohne nicht wenigstens etwas Belletristisches gelesen zu haben!“
Was bleibt zu tun?
Offen ist die Frage, wie wir eine menschenwürdige Versorgung von schwer kranken und sterbenden Menschen angesichts wachsender Zahlen von alten und hilfebedürftigen Menschen finanziell und organisatorisch regeln können. Wie können sich unsere Institutionen des Gesundheitswesens auf diese Aufgabe noch besser einstellen? Wie bezahlen wir die Menschen, die in dem Bereich tätig sind? Oder ist das ein Bereich, in dem mehr ehrenamtliche Tätigkeit sinnvoll eingesetzt werden kann? Da muss man ehrlicherweise sagen, dass wir das noch nicht gelöst haben. Und der Problemdruck wächst. Je länger wir damit warten, diese Fragen anzugehen, umso schwieriger wird es sein, zu einer Lösung zu kommen.